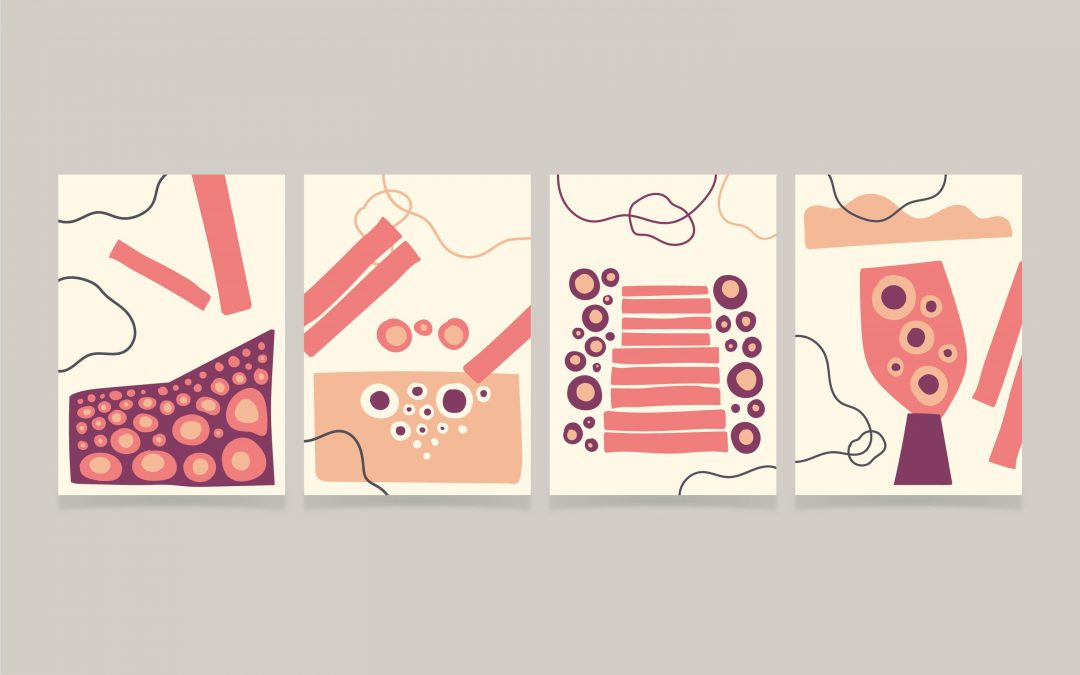Verhalten ist selten „nur persönlich“. Es ist eingebettet in Gruppendynamiken und Kontexten, in expliziten und unausgesprochenen Regeln, in Zugehörigkeit und Abgrenzung, wie Colin Fisher es in The Collective Edge [1] beschreibt. Um Verhalten zu verstehen, müssen wir begreifen, wie Gruppen uns formen und wie sie ständig dazu einladen, uns ihren unausgesprochenen Normen anzupassen.
Fisher geht der Frage nach, was ein echtes Team ausmacht, wann es wirklich mehr ist als die Summe seiner Teile und welche Rolle Aufgaben, Struktur und Zusammensetzung dabei spielen.
Groupiness als Grundlage
- Es gibt eine gemeinsame Aufgabe, für die alle Verantwortung tragen, nicht nur zwei Leistungsträger plus Zaungäste.
- Es existieren erkennbare Interaktionsmuster, z.B. wie wir entscheiden, priorisieren, eskalieren.
- Das Team teilt ein gemeinsames „Schicksal“: Erfolg oder Scheitern betrifft alle, nicht nur einzelne Rollen.
klar begrenzte, stabile Einheiten, die voneinander abhängig an einem gemeinsamen Zweck arbeiten.Für Teamentwicklung ist das der Startpunkt: Wenn nicht klar ist, wer wirklich das Team ist und wofür es gemeinsam Verantwortung trägt, bleiben alle Gespräche über „bessere Zusammenarbeit“ an der Oberfläche und es wird kosmetisch an Verhalten geschraubt, ohne am eigentlichen Setting etwas zu ändern.
Ist das Team besser als die Summe seiner Teile?
Jein.
 Bei einfachen, klar strukturierten Tätigkeiten oder Routineaufgaben zeigen Studien: Gruppen leisten pro Kopf oft weniger als Einzelne. Soziale Trägheit („social loafing“) und Koordinationsaufwand fressen die Leistung auf. Ich klatsche allein lauter als in der Gruppe, weil ich weiß, dass die anderen ja auch klatschen.
Bei einfachen, klar strukturierten Tätigkeiten oder Routineaufgaben zeigen Studien: Gruppen leisten pro Kopf oft weniger als Einzelne. Soziale Trägheit („social loafing“) und Koordinationsaufwand fressen die Leistung auf. Ich klatsche allein lauter als in der Gruppe, weil ich weiß, dass die anderen ja auch klatschen.
Sobald die Aufgaben jedoch durch Ambiguität, Innovation oder mehrere Perspektiven komplex werden, sieht das Bild anders aus:
-
-
- Kleine Teams finden bei komplexen Problemen bessere Lösungen, effizienter als selbst die besten Einzelpersonen.
- Historische und aktuelle Durchbrüche (Forschung, Technik, soziale Innovation) sind fast immer Gemeinschaftsleistungen realer Teams, auch wenn sie häufig einzelnen Personen zugeschrieben werden.
-
Sie lohnen sich dort, wo Komplexität und Interdependenz hoch sind und wo Struktur, Aufgabe und Zusammensetzung eine echte gemeinsame Leistung ermöglichen.
Tuckman – und warum das Bild zu kurz greift
Für reine Trainingsgruppen passt dieses Bild durchaus. Dort steht die Gruppe selbst im Mittelpunkt: Lernen, Austausch, persönliche Entwicklung. In realen Arbeitsteams, die unter Zeitdruck Ergebnisse liefern sollen, führt diese Logik aber schnell in die Irre. Wir warten unbewusst auf die „Storming-Phase“, planen Teambuilding-Maßnahmen und wundern uns, dass die Performance trotzdem nicht kommt.
Studien zeigen, dass wir unsere Wahrnehmung von „Teamchemie“ stark im Rückblick konstruieren. Wenn das Ergebnis gut war, erleben wir die Zusammenarbeit im Nachhinein als harmonisch und gut organisiert; wenn es schlecht lief, erscheinen uns plötzlich Konflikte, Missverständnisse und fehlendes Vertrauen viel größer. Mit anderen Worten: Gute Beziehungen sind oft eine Folge gelungener Zusammenarbeit, nicht nur deren Voraussetzung.
Ein modernerer Blick auf Teams dreht diese Reihenfolge daher um:
- Nicht: Erst Vertrauen, dann Leistung.
- Sondern: Klare Struktur, gute Aufgaben, ein bewusster Start und regelmäßige Retrospektiven und dann wächst Vertrauen im Tun.
Was eine gute Aufgabe ausmacht
Die wichtigste Stellschraube für Motivation und Zusammenarbeit ist die Aufgabe selbst. Hackman & Oldham [3] zeigen, dass das Task Design einen enormen Anteil an Leistung und Zufriedenheit erklärt. Eine gute Teamaufgabe…
- bietet Vielfalt: unterschiedliche Tätigkeiten statt stupider Wiederholung
- liefert Identität: man erkennt „Das ist unser Ergebnis“, nicht nur atomisierte Mikroschritte
- stiftet Bedeutung: sie ist spürbar wichtig für Kunden, Nutzer oder das System
- gibt direktes Feedback: Fortschritt wird im Tun sichtbar, nicht nur im Jahresgespräch
- lässt Autonomie zu: Ziele sind klar, der Weg dorthin liegt weitgehend in der Hand des Teams.
Solche Aufgaben reduzieren Prozessverluste, z.B. die oben genannte soziale Trägheit und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass echte Synergien (ja, ich weiß, DAS Unwort!) entstehen. Sie bilden vielmehr den inhaltlichen Resonanzraum, in dem Zuhören und Dialog überhaupt Wirkung entfalten können.
Struktur als stiller Hebel – die 60–30–10-Regel
Damit schließt sich der Kreis zur Teamstruktur. Wageman & Lowe [4] bringen es mit der 60–30–10-Regel auf den Punkt:
- 60% der Teamwirksamkeit hängen an der Struktur, die zu Beginn festgelegt wird: Teamgrenzen, Zusammensetzung (3–7 Kernmitglieder, passende Skills, soziale Sensitivität), Ziele, Aufgaben, Normen. Diese Struktur wird in Abständen angepasst, z.B. bei Re-Teaming Situationen oder neuen Projekten.
- 30% entstehen direkt beim Start: Wie der Zweck erklärt, Zugehörigkeit geklärt, Rollen und Arbeitsweisen besprochen und erste Schritte definiert werden.
- 10% entfallen auf laufendes Coaching: Nachjustieren, Klären, Unterstützen im Prozess.
In vielen Organisationen ist diese Logik umgedreht: Man steckt enorme Energie in die letzten 10% (Konfliktmoderation, Workshops, Coaching), während Struktur- und Launchfragen verblüffend vage bleiben. Sind die 60% wirklich genutzt worden, bevor die 10% dramatisiert werden?
Die Ansatzpunkte liegen demnach hier: 
- Groupiness bewusst gestalten (klare Grenzen, gemeinsame Verantwortung).
- Teams vor allem dort einsetzen, wo sie bei Komplexität wirklich einen Mehrwert gegenüber Einzelarbeit haben.
- Das Tuckman-Narrativ behutsam ablösen durch ein Bild, in dem Zusammenarbeit aus Struktur, Aufgabe und gemeinsamen Erfahrungen entsteht.
- Aufgaben so designen, dass sie Sinn, Identität und Gestaltungsspielraum bieten und damit echten Dialog ermöglichen.
- Struktur und Teamstart als kommunikative Führungsaufgabe verstehen. Im Gespräch mit dem Team aushandeln und Klarheit schaffen, wie die Besetzung aussieht, wer wofür Verantwortung trägt, wie Entscheidungen getroffen werden und welche Spielregeln gelten. Den Start eines Teams oder Projekts nicht nur als formalen Akt und das Zeichnen eines Organigramms verstehen, sondern als das zentrale Dialogformat, in dem Sinn, Ziele, Rollen, Erwartungen und Grenzen so besprochen werden, dass alle ein gemeinsames Bild teilen.
Leere Gefäße
Menschen sind keine „leeren Gefäße“, die sich mit ein paar cleveren Mini-Interventionen dauerhaft umprogrammieren lassen. Viel stärker als lange angenommen [5] prägen stabile Selbstbilder, Motive und Persönlichkeitsmerkmale, welche Struktur-, Rollen- und Kommunikationsangebote ein Team überhaupt annehmen kann und welche es eher abprallen lässt.
Für Teamentwicklung heißt das: Es reicht nicht, an Meetings, Wortwahl oder Raumaufteilung zu schrauben. Wirkungsvoll wird es dort, wo wir Aufgaben, Struktur und Zusammensetzung so designen, dass sie zu den Menschen passen, die darin arbeiten, und ihre vorhandenen Muster bewusst aufgreifen.
„Wir brauchen mal eine Teamentwicklung“
Warum habe ich das Thema „Teams“ ausgewählt? Mein Angebot setzt genau an dieser Schnittstelle an: ECHO Listening plus Organisations- und Teamentwicklung.
Mit ECHO mache ich sichtbar, wie in ein Team kommuniziert, welche Informationen Resonanz finden und was systematisch untergeht.
Mit meiner OE-Brille schaue ich gleichzeitig auf Struktur, Aufgaben, Ziele und Rollen und frage so viel gezielter: Liegt der Schmerz in der Kommunikation oder in der Struktur – oder in der Kombination daraus? Dadurch wird aus „Wir brauchen mal eine Teamentwicklung“ eine passgenaue Intervention, die an den Stellen ansetzt, an denen Teams wirklich wirksamer werden können.
Wenn diese Themen in deinem eigenen Führungsalltag oder in deiner Organisation andocken, dann lass uns sprechen!
Quellen:
[1] Fisher, 2025: The Collective Edge
[2] Hackmann, Richard, 2013: Leading Teams, HBR
[3] Hackman, Oldham, 1980: Work Redesign; bestätigt durch ein Meta-Analyse von Humphrey, Nahrgang und Morgeson, 2007: Integrating Motivational, Social, and Contextual Work Design Features
[4] Wageman, Lowe, 2019: Designing, Launching and Coaching Teams: The 60-30-10 Rule and Its Implications for Team Coaching
[5] Klein, Swann, 2026: The Empty-Self Metaphor
Bilder über freepik